„In der Kinderkardiologie und -pneumologie überflutet uns Long-Covid“
Mit politischer Prominenz und einem Kinderchor wurde vor einem halben Jahr in Bayreuth das kinder- und jugendmedizinische Zentrum med4kidz eröffnet. Auf rund 900 Quadratmetern Praxisfläche arbeiten elf Pädiaterinnen und Pädiater interdisziplinär zusammen. Außerdem ist das Zentrum Stützpunktpraxis des bayerischen Modellprojekts „Post-COVID Kids Bavaria“. Dr. Gerald Hofner hat die Praxis mitgegründet und ist Gesellschafter. Der Kinderpneumologe und -kardiologe erzählt im Interview mit dem änd, welche Herausforderungen die Pädiatrie meistern muss, wie er die Corona-Debatte zwischen „Kinderdurchseuchung“ und psychosozialen Folgen erlebt und wie es um die Zukunft von Kinder- und Jugendarztpraxen steht.
 ©privat
Hofner: Es wird weniger Einzelpraxen, sondern zunehmend größere Zentren oder MVZ geben.
©privat
Hofner: Es wird weniger Einzelpraxen, sondern zunehmend größere Zentren oder MVZ geben.
Herr Dr. Hofner, die Pädiatrie hat sich in den vergangenen Jahrzehnten massiv verändert. Geben Sie uns einen Einblick.
In den sechziger und siebziger Jahren drehte sich alles vor allem um Infektionskrankheiten in der Kinder- und Jugendmedizin. Man hat nicht wirklich wahrgenommen, dass Kinder auch eine Seele haben und in die Gesellschaft integriert werden müssen. In den siebziger Jahren kamen dann die Vorsorgeuntersuchungen – die psychosoziale Kindergesundheit wurde also mehr in den Fokus gerückt. Heute ist unsere Arbeit viel komplexer. Wir haben in der Pädiatrie vier große Bereiche, die unser kinder- und jugendmedizinisches Zentrum med4kidz in Bayreuth auch abbildet.
Welche Bereiche sind das?
Das ist als Erstes die Akutsprechstunde für Infektionserkrankungen oder Verletzungen. Dann haben wir Pädiater auch einen staatlichen Auftrag beispielsweise mit den Früherkennungsuntersuchungen oder der verpflichtenden Masernimpfung. Dazu gehören aber auch Themen wie Prophylaxe, Früherkennung und Überwachung von Kindesmissbrauch oder -verwahrlosung. Der dritte Bereich ist der psychosoziale Bereich, der in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen hat – durch wachsende Anforderungen in Schule und Gesellschaft. Dabei geht es um Themen wie Schulprobleme, aber auch Suchtprävention oder Adipositas. Durch die Pandemie haben viele Kinder und Jugendliche erheblich an Gewicht zugenommen. Das Thema wird uns auch in Zukunft noch sehr beschäftigen. Der vierte Part ist der fachärztliche Bereich. Die Pädiatrie bildet ja alle wichtigen Fächer der Erwachsenen nochmal gesondert ab.
Sie haben vor einem halben Jahr das medizinische Zentrum med4kidz in Bayreuth gegründet. Was ist Ihr Konzept?
med4kidz vereint all die Bereiche, die ich erläutert habe. Unsere Arbeit als Pädiater ist in den vergangenen Jahren viel komplexer, breiter und spezialisierter geworden. Wir arbeiten mit Kolleginnen und Kollegen unterschiedlicher Disziplinen zusammen. In einer Einzelpraxis ist man mit der Fülle der Themen und Anforderungen komplett überfordert. Wenn es beispielsweise um psychosoziale Themen geht, kann sie nur den ersten Punkt machen. Wenn man eine hohe Qualität anbieten möchte, bedarf es auch entsprechender Weiterbildung und Spezialisierung. Wir arbeiten mit komplexen Testsystemen und in manchen Fällen auch im engen Austausch mit dem Jugendamt. Wir haben auch eine Notfallpraxis angeschlossen, sodass der Zugang zur Akutmedizin immer gewährleistet ist. Außerdem haben wir fachärztlich ein Lungen- und Herzzentrum sowie die Kinderdiabetologie etabliert. Mit unseren Schwerpunkten in der Kinderkardiologie und -pneumologie können wir in unserem Zentrum schon ein breites medizinisches Spektrum anbieten. Das kann eine einzelne Kinderarztpraxis kaum leisten.
Wie sind Sie als Praxis organisiert?
Wir sind eine klassische Gemeinschaftspraxis und haben rund 7.500 Patienten im Quartal. Die Verantwortung teile ich mir mit zwei Gesellschafterinnen. In der Praxis arbeiten elf Ärztinnen und Ärzte – davon zwei Weiterbildungsassistentinnen und 35 MFA, oft in Teilzeit, auf 900 Quadratmetern Praxisfläche in sehr schönen Räumen. Wir sehen uns als interdisziplinäres medizinisches Zentrum. Trotz der Größe ist uns eine enge, persönliche Arzt-Patienten-Beziehung ein Herzensanliegen, gerade weil es um Kinder geht. Wir versorgen hier Kinder und Jugendliche aus der ganzen Region.
Ihre Praxis ist Stützpunktpraxis des bayerischen Modellprojekts „Post-COVID Kids Bavaria“. Das heißt, Sie sind zentrale Anlaufstelle für Kinder und Jugendliche mit Post- oder Long-Covid.
Genau, wir sind für diese Patienten für die Region Oberfranken zuständig. Viele Kinderkliniken in unserer Region sind zu klein und können die fachärztliche Versorgung nicht anbieten. Wir haben das gerne übernommen und behandeln Betroffene bei uns.
Was erleben Sie in Ihrer Praxis?
Im Zentrum für Kinderkardiologie und -pneumologie überflutet uns Long-Covid. Zu zweit sehen wir jeden Tag drei bis fünf Patienten mit Beschwerden nach SARS-CoV2-Infektion. Vor allem sehen wir sehr viele sportliche Kinder und Jugendliche, die über Wochen und Monate nicht mehr leistungsfähig sind zur Beurteilung einer Herz- oder Lungenbeteiligung oder mit Fatigue-Problematik. Das ist kein Vergleich zur Grippe. Wir fragen uns, warum es so viele extrem fitte Patienten betrifft. Wir haben noch keine Antworten darauf. Vielleicht auch, weil ihre Leistung mehr unter Beobachtung steht und Einbrüche einfach viel spürbarer sind als bei Kindern oder Jugendlichen, die den Tag eher auf dem Sofa verbringen. Die Probleme treffen bei geimpften und ungeimpften Kindern und Jugendlichen auf. Rund 25 Prozent unserer Patienten sind nicht geimpft. Ob sie häufiger an den Folgen einer Infektion leiden, hängt wohl stark vom Subtyp ab. Wir können das leider nicht in Zahlen fassen. Im Vergleich zu PIMS kann man Long-Covid noch nicht behandeln. Das Thema Fatique-Syndrom hat man in der Forschung Jahrzehnte verpennt. Es wurde nie ernst genommen, immer in die psychosomatische Ecke geschoben. Jetzt wird das Thema massiv durch Corona angeschoben und wird auch noch volkswirtschaftlich eine hohe Bedeutung für uns alle bekommen. Wir hatten in Bayern aber auch schon einen PIMS-Fall nach einer Impfung – auch darüber müssen wir offen sprechen. Obwohl wir ganz klar die Impfung nach der Stiko-Empfehlung für Kinder und Jugendliche befürworten.
In den vergangenen zweieinhalb Jahren der Pandemie gab es sehr kontroverse Diskussionen: Die eine Seite kritisierte eine „Kinderdurchseuchung“ an den Schulen, die andere warnte vor weiteren Lockdowns und den massiven psychosozialen Kollateralschäden. Wo stehen Sie bei der Debatte?
Ich gehöre zu den Ärzten, die immer versucht haben, beide Seiten zu sehen. Die Diskussionen wurden in der Vergangenheit sehr nach dem Schwarz-Weiß-Prinzip geführt. Ich glaube, das hat sich in den vergangenen Monaten etwas geändert und ist differenzierter geworden. Aber ich muss ganz klar sagen: Familien haben keine Lobby. Sie sind in der Rushhour des Lebens und haben keine Zeit, laut zu werden. Es wurden Milliarden in Testzentren gesteckt, aber viel zu wenig in die Forschung. Wir wissen immer noch nicht, welche Maßnahmen ausgewogen greifen. Als Kardiologe sehe ich die Autoimmunprozesse, die Covid-19 auslöst. Von daher verstehe ich die Ängste vieler Eltern. Gerade die Schattenfamilien benötigen besonderen Schutz. Andererseits wurde von der Politik immer nur auf die Intensivstationen und Belastung des Personals dort geschaut, nicht auf die erheblichen psychosozialen Folgen bei Kindern und Jugendlichen durch die Schulschließungen. Die Kinder hat niemand in der Pandemie interessiert.
Was empfehlen Sie für den Corona-Herbst?
Auf jeden Fall impfen, auch wenn die Impfung aktuell nicht vor einer Infektion schützt, aber sie ist der ganz wichtige Erstkontakt mit dem Spikeprotein. Es sollte für alle Kinder und Jugendlichen immer die Möglichkeit für Homeschooling geben – gerade für chronisch kranke Kinder oder Familien, die besonders gefährdet sind. Auch die Maske bringt einen Vorteil. Ich sehe für Kinder und Jugendliche keine Probleme beim Maskentragen – auch nicht für Asthmatiker. Bei den Luftfilteranlagen bin ich eher skeptisch. Da haben mich die Ergebnisse bisher nicht überzeugt.
Sprechen wir über die Lage der Pädiaterinnen und Pädiater. Der Ärztemangel zeichnet sich überall ab. In einigen Regionen in Deutschland suchen Eltern vergeblich nach einer Kinderarztpraxis. Woran liegt das?
Wir haben ein strukturelles Problem. Gerade in der Pädiatrie haben wir einen enorm hohen Frauenanteil – er liegt bei rund 80 Prozent. Viele junge Ärztinnen mit Kindern wollen erstmal zu Hause bleiben oder arbeiten in Teilzeit. Sie lassen sich häufig nicht mit einer eigenen Praxis nieder. Die zunehmende Work-Life-Balance-Mentalität der nachfolgenden Generationen wird das Problem noch verstärken.
Was muss passieren, damit die Niederlassung wieder attraktiver wird?
Der Notdienst ist zum Beispiel ein großes Manko. Er muss zentralisiert werden. Die Notdienstverpflichtungen sind teilweise brutal. Manche Pädiater müssen sich die Dienste mit nur sechs oder sieben Kollegen teilen. Das hält viele von der Selbstständigkeit ab. Außerdem müssten die Tarife für MFA unbedingt angepasst werden. Was hier alles geleistet wird, wird leider nicht bezahlt. In der Pädiatrie haben wir finanziell leider wenig Spielraum, etwas Gutes für die MFA zu tun.
Wie sieht die Zukunft der kinder- und jugendmedizinischen Versorgung aus?
Es wird weniger Einzelpraxen, sondern zunehmend größere Zentren oder MVZ geben mit verschiedenen Spezialisierungen – so wie med4kidz. Da es in der Pädiatrie viel standardisierte Medizin gibt und nicht so viele attraktive Leistungen, habe ich keine zu großen Sorgen, dass sich in unserem Bereich investorengetragene MVZ im größeren Stil breit machen werden.






Andrea Gaitanides_adobe_842020584.jpg)

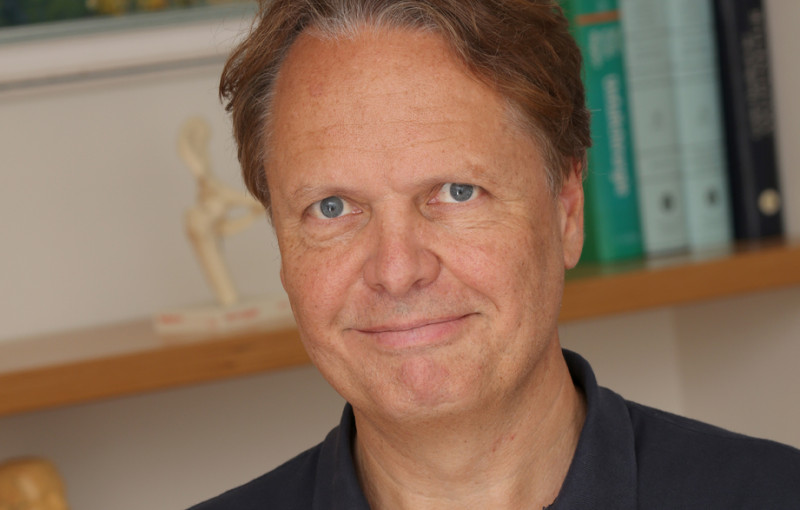



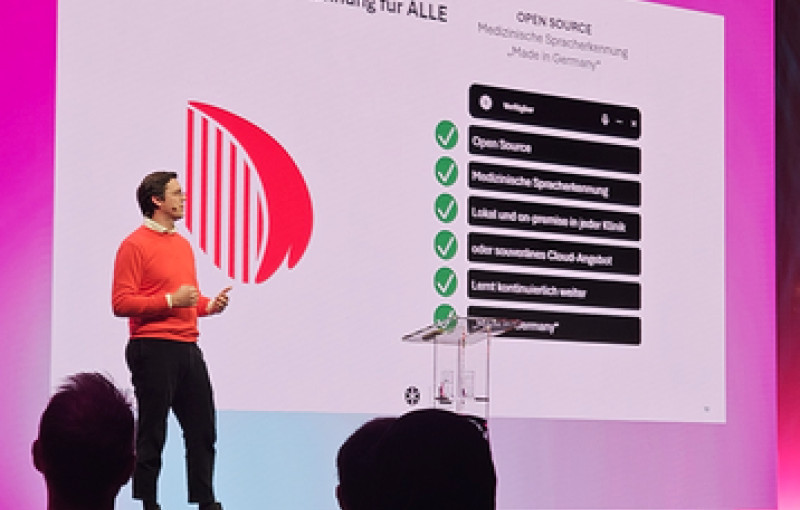
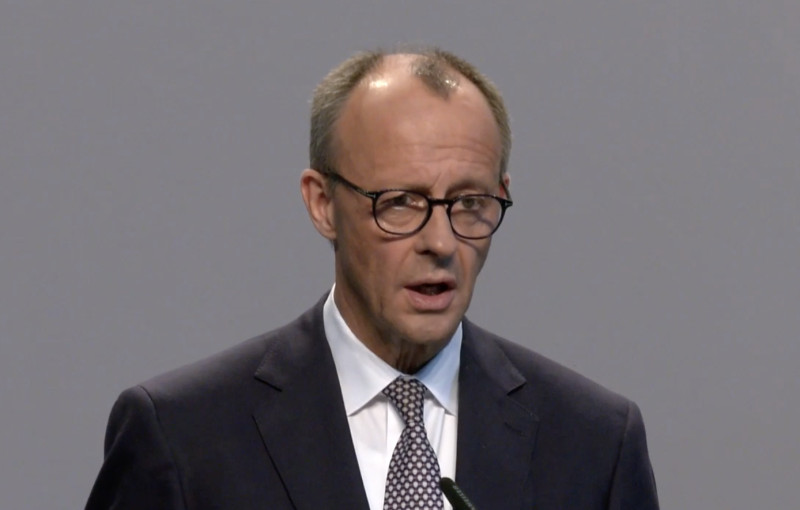






Andrea Gaitanides_adobe_570568393.jpg)
